DER SCREENER – Teil 2
Nachdem ich meinen Mystery Thriller DER SCREENER – Teil 1 letztes Jahr komplett revidiert und ein völlig neues ‚Ende‘ konzipiert habe, fügen sich die Puzzle-Teile endlich zusammen: Desmond Parkers Odyssee geht nämlich weiter, und auch diesmal führt die Reise an Orte des Grauens und des Unheimlichen …
Anbei die exklusive erste Kostprobe für Schatzkiste-LeserInnen:
DER SCREENER – Teil 2
(Leseprobe)
JETZT
Eingesperrt
Blue Oak Forensic Clinic, Clifton,
New Jersey – Donnerstag, 13:22 Uhr
Desmond betritt das Kinderzimmer, und der Horror beginnt. Die Echtheit des Erlebens ist mörderisch. Unerträglich. Das Mobile mit dem Planetensystem an der Decke bewegt sich leicht im Luftzug, den das Öffnen der Tür verursacht hat. Auf dem blauen Teppichboden liegt eine Handpuppe von Kermit, dem Frosch – ein Spielzeug, mit dem Desmonds Vater in seiner Kindheit gern gespielt und das er für seine Kinder aufbewahrt hat.
Ich will das nicht sehen.
Wie von einem unsichtbaren, frostigen Wind vorwärtsgetrieben geht Desmond weiter und bleibt in der Mitte des Zimmers stehen. Die beiden Wiegen – solides Eichenholz, vom Vater selbst gezimmert – stehen in den Ecken des Raumes, neben dem Fenster, schaukeln langsam hin und her.
Ich will nicht …
Desmond atmet schneller, sein Herz pocht bis in seinen Hals. Alles in ihm schreit danach, auf dem Absatz kehrtzumachen und aus dem Zimmer zu fliehen, bevor das Unsägliche geschieht, das Unvermeidliche, doch er kann nicht. Seine Füße kleben auf dem Teppichboden.
Mit leicht geöffnetem Mund starrt er auf die hauchdünnen Schleier über den Wiegen. Schleier, die den Eltern den Anblick der beiden toten Babys ersparen sollen. Jasper kam ein Jahr nach Desmond zur Welt. Winston ein weiteres Jahr später. Beide starben wenige Tage nach ihrer Geburt am plötzlichen Kindstod.
Bitte … Desmonds Haut kribbelt, als strichen unsichtbare Spinnweben über sie. Lasst mich!
Wie in einem makabren Puppenspiel gleiten die Totenschleier von den Wiegen, und Desmond sieht seine beiden Brüder, sieht ihre blau angelaufenen Gesichter.
Starre Augen richten sich auf ihn.
Desmond.Jaspers winziger Babymund verzieht sich zu einem seelenlosen Lächeln. Du solltest tot sein, nicht wir …
Wir werden dich holen, Desmond,bestätigt Winston. Schon bald.
Winzige Hände greifen nach dem Rand der Wiegen, und im Zeitlupentempo der Unvermeidlichkeit klettern die Säuglinge heraus. Desmond versucht zu schreien, aber seine Stimmbänder sind gelähmt. Er konzentriert sich auf seinen Körper, auf die Starre, die er durchbrechen muss, wenn er überleben will. Mit aller Willenskraft kämpft er dagegen an, gewinnt die Kontrolle über seine Muskeln zurück. Er dreht sich um, bereit, aus dem Zimmer zu rennen – und bleibt stehen, als wäre er gegen eine Wand gerannt.
Im Türrahmen stehen seine Eltern, einen Ausdruck von ultimativem Schock auf den Gesichtern. Dann fühlt Desmond, wie von hinten winzige Hände nach seinen Beinen greifen, und er schreit, schreit, schreit …
_____
Keuchend setzt sich Desmond im Bett auf, schaut verwirrt um sich. Ein winziges Zimmer. Ein Tisch, ein Stuhl, ein WC, ein Waschbecken. Sonst nichts.
Meine Zelle.
Wie immer ist er nach dem Mittagessen – einer Mahlzeit, die einem koreanischen Kriegsgefangenenlager würdig gewesen wäre – eingeschlafen. Und wie jedes Mal realisiert er, wie viel klarer und echter seine Albträume sind als sein Leben im Wachzustand. Wach mit Psycho-Drogen … ein schlechter Witz.
Der Traum, eben noch da, beginnt sich zu verflüchtigen, weicht der wattigen Leere, die Desmonds Kopf erfüllt, seit er in der Klinik ist. Er schaut zum vergitterten Fenster, sieht das trübe Licht eines frischgeborenen Frühlings, der immer noch nach Winter riecht.
Auf gummiartigen Beinen erhebt er sich und geht zur Tür, den Oberkörper vornübergebeugt wie ein Parkinson-Patient. Trotz der Benommenheit beherrscht ihn Tag und Nacht eine innere Unruhe, die ihn dazu zwingt, ständig umherzugehen, oder an Ort und Stelle zu treten, in den Knien zu wippen. Er kennt die Akathisie, eine der typischen Nebenwirkungen der Neuroleptika, von seiner Ausbildung, und von seinen eigenen Patienten. Die Tatsache, dass er auf einmal die Rolle wechseln musste, dass er der Patient ist, erscheint ihm wie göttliche Ironie.
Du bist kein Patient, korrigiert er sich. Du bist ein Insasse. Ein Gefangener. Ein Mörder.
Als er nach dem Türknauf greift, fällt ihm auf, dass das leichte Zittern seiner Finger stärker geworden ist. Als wäre ich in wenigen Monaten um vierzig Jahre gealtert.
Er zieht die Tür auf. Die Sicherheitstüren sind tagsüber geöffnet, so dass sich die zwölf Insassen der Station D3 im Korridor oder im Aufenthaltsraum frei bewegen können. Doch von sieben Uhr abends bis sieben Uhr morgens verwandelt sich das Zimmer in eine Gefängniszelle. Schreien, Betteln und mit dem Kopf gegen die Tür Hämmern verleitet die Nachtwärter höchstens zu einem gelangweilten Blick durch den Spion. Solange niemand im eigenen Blut liegt oder einen epileptischen Anfall hat, bleiben die Türen nachts geschlossen.
Desmond schlurft den Korridor entlang. Wie jeden Morgen beginnt er seine quälend langsame Tour, dreißig Längen zwischen Stationszimmer und Aufenthaltsraum, dreißig mal zwanzig Meter, um seine Muskeln nicht völlig verkümmern zu lassen. Neben ihm ziehen weiße Wände vorbei, unter ihm grauer Linoleumboden. Der Geruch von Desinfektionsmittel gibt ihm das Gefühl, eine tückische Nachahmung von Luft zu atmen.
„Hey, Parker!“
Desmond bleibt stehen, zwingt sich, den Kopf zu heben. Wenige Schritte vor ihm streckt Stanimir seinen Kopf aus dem Stationszimmer.
„Na?“ Der massige Bulgare winkt ihm mit dem Schlagstock zu, einer Kombination von Knüppel und elektrischem Viehtreiber. „Wie geht’s meinem Lieblings-Menschenöffner denn so?“
Desmond meidet die hellgrauen Augen des Wärters. Du kannst mich nicht provozieren. Zu häufig hat es der Bulgare geschafft, Desmond aus der Reserve zu locken, ihn zu reizen, bis er die Kontrolle verlor. Stanimir hatte nur auf die Gelegenheit gewartet, Desmond mit dem Viehtreiber zu züchtigen, ihm Strom durch den Körper zu jagen, bis er nichts als ein zuckendes, bewusstloses Stück Fleisch war.
Nicht heute.
Wortlos macht Desmond kehrt und schlurft in die andere Richtung. Versucht, nicht daran zu denken, dass er seit zwei Monaten und zehn Tagen Insasse eines menschenverachtenden Höllenlochs ist, das sich Klinik nennt – keine zwanzig Meilen von der Stadt entfernt, in der er in einem früheren Leben, vor Monaten, wohnte und als Psychologe praktizierte. Ein Steinwurf vom Big Apple, und doch in einer fremden Galaxis.
Er schaut auf seine Füße. Links. Rechts. Links. Rechts.
Sein Lebensgefühl ist ein Schrei, der sich tief in der Brust aufbaut, ohne es jemals zu schaffen, sich nach außen zu entladen. Während sein Gemüt in dichte Watte gepackt ist, wimmeln Kolonien von Geisterameisen durch seine Adern, seine Eingeweide, seine Seele.
Die Medikamente, die man ihm die ersten paar Wochen aufzwingen musste, nimmt er inzwischen freiwillig ein, gefügig wie ein Lamm. So sehr sie seinen Geist lähmen, so gründlich betäuben sie auch den Schmerz; die nagenden Schuldgefühle, versagt zu haben; die Selbstzerfleischung, dass er Jean nicht retten konnte. Nicht zuletzt unterdrücken die Pillen Desmonds ‚Talent‘ – den Fluch, den nahenden Tod in anderen Menschen zu sehen. Keine verschwimmenden Farben mehr. Kein unerträglicher Druck in der Stirn. Keine Übelkeit. Keine Wirbel, die um sein Gegenüber rotieren wie bösartige Tornados.
Das Einzige, was selbst die hochdosierten Neuroleptika und Benzodiazepine nicht dämpfen können, ist die tödliche Wut auf den Kalabrier.
Michael ‚Die Flamme‘ Coppola ist tot, mit Jean im Sturm untergegangen, und so sehr Desmond alles tun würde, Jean wieder lebendig in seinen Armen zu halten, so unbändig ist das Verlangen, den Mafioso wieder lebendig zu sehen, bloß, um ihn ein zweites Mal zu töten. Und noch einmal. Und immer wieder.
Unerreichbar, für immer … genau wie Jean.
Seit er die Medikamente schluckt, ist er sich selbst fremd, kann manchmal beinahe daran glauben, dass all das Grauen der letzten Monate jemand anderem zugestoßen ist – einem Fremden, den er nur geträumt hat.
Er schaut auf seine Füße, bewegt sie mit der trägen Regelmäßigkeit eines Standuhrpendels. Links. Rechts. Links. Rechts. Sein zu langes Haar hängt vor seinen Augen, schwingt zum schleppenden Rhythmus seiner Schritte hin und her. Hinter dem buschigen Vollbart schürzen sich die Lippen tickartig.
Vor ihm öffnet sich eine Tür, und aus Zimmer 11 stapft Tyrone Briggs heraus, ein schwarzer Hüne, der sich für Luke Cage hält. Die Ähnlichkeit mit dem Comic-Helden hält sich in Grenzen, aber die Körpermasse kommt dem Marvel-Vorbild ziemlich nahe. Desmond bewegt sich zur Seite, um Tyrone nicht im Weg zu stehen. Wer dem Muskelpaket in die Quere kommt, riskiert einen Urlaub auf der Krankenstation. Tyrone scheint gegen Beruhigungsmittel ebenso immun zu sein wie gegen Regeln und Anstand.
Desmond erreicht das Ende des Korridors und geht in den offenen Aufenthaltsraum. Acht am Boden festgeschraubte Tische, die Ecken abgerundet, um die Verletzungsgefahr zu verringern. Oben in der Ecke ein Fernseher mit Flachbildschirm und Gitterschutz, auf stumm geschaltet. Zwei Footballmannschaften – Desmond glaubt, die New England Patriots und die New York Giants zu erkennen – gehen wie die Wikinger aufeinander los. Hinten beim Fenster eine Lounge mit verschlissenen Kunstledermöbeln. Ein welliges Poster mit karibischen Inseln an der Wand.
Einer der Wärter – Bill ‚The Moustache‘ Könkerling – hört mit halbem Ohr Charles Lepotte zu, einem kleingewachsenen Mann mit Goldbrille, während er das Footballspiel im Auge behält.
Desmond schleppt sich zur Lounge, lässt sich in einen der Sessel fallen und schaut sich um. Abgesehen vom Wärter befinden sich drei Männer im Aufenthaltsraum: Lepotte, der schmächtige Goldschmied, der sich und seine Familie vergiftet und dummerweise als Einziger überlebt hat, sitzt auf einem der Sessel in Fensternähe, während er Bill die Ungerechtigkeit des Lebens erklärt; Scott Burnette, ein unheimlicher alter Kauz, der seiner Ehefrau die Kehle aufgeschlitzt hat, weil sie die falschen Götter anbetete. Und schließlich Jorge Pacota, der junge Mexikaner mit dem Überbiss, der seine Mutter aus dem vierzehnten Stock geworfen hat. Rastlos tigert er um die Tische herum.
Ein lähmendes Déjà-vu überkommt Desmond. Das erdrückende Gefühl von Stunden, Tagen und Wochen, die zähflüssig ineinander verlaufen wie Melasse, ewig gleiche Szenen des ewig gleichen, sinnlosen Alltags.
Er drückt sich die Handballen auf die Augen, versucht, der unerträglichen Realität seiner Gefangenschaft und den inneren Bildern zu entkommen.
Keine Chance.
Das Geräusch von Schritten lässt ihn aufblicken. Stanimir Balkanski stampft in den Aufenthaltsraum, die grauen Augen hin und her gleitend, eine Hyäne auf der Suche nach einem Opfer.
Er nickt seinem Kollegen zu. „Hey, Bill, kannst du mal eben das Stationszimmer übernehmen? Hab mit unserem Mr. Tortilla hier ein Hühnchen zu rupfen.“
„Geht klar.“ Der hochgewachsene Wärter mit dem gewachsten Schnauzer stelzt aus dem Aufenthaltsraum.
Stanimirs Blick richtet sich auf Jorge.
„Ey amigo!“ Gemütlich spaziert der Bulgare auf den jungen Mexikaner zu. „Dr. Cole hat soeben deine Blutresultate durchgegeben. Gemäß Labor nimmst du deine Medis seit mindestens zwei Wochen nicht mehr ein. Ist das deine Vorstellung von Kooperation?“
„No señor!“ Jorge ist abrupt stehengeblieben, die Augen panisch geweitet. „Ich … ich immer schlucke Medikament, jeden Tag! Ich –“
„Tsk, tsk.“ Stanimir schüttelt den Kopf. „Ungehorsam undLügen? Eine ungesunde Einstellung.“
Der Bulgare hakt den Schlagstock vom Gürtel.
„Señor Stanimir, por favor …“
Stanimir hebt einen tadelnden Zeigefinger. „Schnauze, Jorge. Du kommst jetzt mit mir zum Stationszimmer, wo du deine Medis vor meinen Augen schlucken wirst. Wenn du mir Probleme machst, jage ich dir ein paar Millionen Volt durch deine haarigen Eier.“
„Señor –“
„Cállate, coño.“ Stanimir hält die Elektroden des Schlagstocks direkt vor Jorges Nase, und der Mexikaner verstummt, die Lippen bebend.
Stanimir lächelt dünn. „Und denk dran, dieser Gringo hier lässt sich nicht verarschen. Ich werde dir ins Maul schauen wie bei einem störrischen Esel. Und danach bleibst du zwei Stunden lang schön brav hier im Aufenthaltsraum, damit du die Pillen nicht wieder auskotzt. Nos entendemos?“
Jorge nickt, macht einen großen Bogen um den Elektrostab und rennt aus dem Aufenthaltsraum.
Desmond starrt zum Bulgaren, sieht die kühlen grauen Augen, und für einen Moment sieht er nicht Stanimir dort stehen, sondern Michael Coppola.
Coppola, der Drogenbaron der Upper West Side.
Coppola, der psychopathische Pyromane.
Coppola, das Monster, das für Jeans Tod verantwortlich ist.
Stanimir fängt den Blick auf und spaziert auf Desmond zu, den Stock in der Hand.
„Hey, Seelenbohrer! Du guckst mich an, als wäre ich deiner Mutter an die Wäsche gegangen! Findest du, dass ich zu unserem Mexikanischen Freund zu streng war?“
Desmond zwingt sich, wegzuschauen. Schweigt.
Stanimir hält ihm die Stockspitze unter das Kinn. „Aber natürlich findest du das! Du warst ja schließlich Psychologe, bevor dir selbst ein paar Latten vom Zaun gefallen sind. Und ein guter Psychologe ist ein Gutmensch, ein Moralapostel, der die Welt verbessern will. Also sag mir“ – er hebt Desmonds Kinn, bis sich ihre Augen begegnen – „war ich zu streng?“
„Nein, Sir.“
Stanimir zieht den Stock zurück. „Was für ’ne Affenschande … offenbar machen dich die Neuroleptika nicht nur zu einem Gemüse, sondern lassen dir auch die Eier schrumpfen.“
Er klickt den Stock an den Gürtel und verlässt den Aufenthaltsraum. Desmond denkt an den völlig verstörten Mexikaner, stellt sich vor, wie dieser im Stationszimmer gezwungen wird, gegen seinen Willen Medikamente zu schlucken, die sein Denken, sein Fühlen, sein ganzes Sein betäuben. Medikamente, die ich freiwillig schlucke. Unter dem Mantel von Benommenheit fühlt Desmond, wie sich tief in ihm etwas regt. Wut? Selbstekel? Er weiß es nicht.
„Aufwachen“, leiert jemand.
Desmond schaut sich um und sieht, wie der alte Burnette direkt neben ihm steht und ihn mit seinen stechenden Augen beobachtet – ein Wissenschaftler, der ein exotisches Insekt unter dem Mikroskop studiert. Die nussbraunen Augen zucken hin und her.
Ein Nystagmus,denkt Desmond. Von Geburt an oder von den Medikamenten?
Desmond hält dem Blick Stand, sogleich auf der Hut. Seit seiner Einlieferung in die Blue Oak Forensic Clinic hat ihn der merkwürdige Greis noch nie angesprochen. Desmond vermutet, dass Burnette an einer ausgeprägten Wahnstörung leidet, vermutlich an einer Schizophrenie. Die meiste Zeit schleicht der ehemalige Optiker wie ein Geist durch die Gänge, lächelt sein gruseliges Dauerlächeln und flüstert unverständliches Zeug, als spräche er mit unsichtbaren Verbündeten.
„Auuuuf-wachen!“ wiederholt Scott Burnette in einem unheimlichen Singsang.
Mühselig stemmt sich Desmond auf die Beine. „Lass mich in Ruhe.“
Erstaunlich leichtfüßig folgt der Alte Desmond zum Korridor. Desmond bleibt stehen und fixiert den dürren Alten. Neben der fast vollständigen Glatze ragen seitlich zwei wirre, weiße Haarbüschel hervor. Obwohl er größer als Desmond ist, schafft er es irgendwie, ihn von unten anzuschauen, was ihm etwas Arglistiges verleiht.
„Du bist es!“ Burnette macht mit den Händen kreisende Bewegungen, ein Lehrer, der einen Schüler beim Lösen eines schwierigen Rätsels ermutigt. „Hab dich beobachtet, Kumpel, und ich weiß, du bist es!“
„Wasbin ich?“ Desmond verschränkt die Arme. Tief in seinen Knochen fühlt er die bleierne Müdigkeit, die über die letzten zwei Monate zu seiner treusten Begleiterin geworden ist, und er sehnt sich nach seinem Bett, wissend, dass er es wegen der Akathisie dort keine zehn Minuten aushalten wird.
Burnettes Augen sind zwei zuckende Kiesel.
„Du bist der Todesengel!“
„Was?“
Der Alte lächelt listig. „Der Todesengel! Der Doppelnull-Agent der Göttin!“
„Ach ja? Danke für die Info. Und jetzt lass mich in Ruhe.“ Desmond wendet sich ab und schlurft weiter. Burnette weicht ihm nicht von der Seite.
„Du kannst den Willen der Göttin nicht ignorieren, Kumpel! Sie ist stärker, so viel stärker als wir … aber sie braucht uns. Braucht dich!“
„Und du brauchst stärkere Medikamente, mein Freund.“ Desmond hat sein Zimmer erreicht, blickt zur Sicherheit auf die Nummer. Sein Verstand ist derart benebelt, dass er schon zweimal das falsche Zimmer betreten hat. Ein Fehler, der gefährlich sein kann, wenn man zum Beispiel das Zimmer von Tyrone alias Luke Cage betritt.
Nr. 5 – alles in Ordnung.
Er öffnet die Tür. Als der Alte Anstalten macht, ihm zu folgen, schiebt ihn Desmond sanft, aber bestimmt aus dem Zimmer.
„Oh ja!“ gluckst Burnette. „Der Todesengel braucht seine Privatsphäre … um den nächsten Schritt zu planen.“
„Was auch immer.“
Desmond schließt die Tür, wartet, bis er sicher ist, dass der alte Kauz ihm nicht doch noch ins Zimmer folgt. Dann schlurft er zum Bett und lässt sich auf die Matratze sinken. Doch während sein Körper sogleich auf die horizontale Lage reagiert, sich nach dem Schlaf des Vergessens sehnt, durchströmt ein rastloser Strom sein Gehirn.
Passiert das alles wirklich? Hier und jetzt?
Desmond ist, als wäre er durch eine unsichtbare Falltür in eine parallele Dimension gestürzt, eine Dimension der Boshaftigkeit und des Wahnsinns. Die Vorstellung, dass er vor knapp einem halben Jahr ein völlig normales Leben in Manhattan führte, kommt ihm unwirklich vor. Unfassbar.
Vielleicht bin ich wirklich verrückt. Gaga. Durchgedreht.
Eine plötzliche Nervosität erfasst ihn, macht es ihm unmöglich, liegenzubleiben. Neben seinen Neuroleptika, die er jeden Morgen und Abend schluckt, hat er Ativan in Reserve, ein Beruhigungsmittel, das er bei übermäßiger Anspannung verlangen darf – eine Option, die er seit seiner Zwangseinweisung erst zweimal in Anspruch genommen hat.
Er steht auf und geht zum Stationszimmer hinüber. Wie nebenbei bemerkt er, dass er wesentlich schneller geht als zuvor, angetrieben durch das Verlangen nach dem Tranquilizer. Eine Welle von Selbstekel erfasst ihn. Bin ich schon so weit? Ein verdammter Junkie?
Beim Stationszimmer angelangt hebt er die Hand, um an die Scheibe zu klopfen – und lässt sie wieder sinken. Durch das Fenster sieht er, wie Stanimir und Bill den jungen Mexikaner unsanft auf die Füße reißen. Jorge hat den glasigen Blick eines Boxers, der gerade K.o. gegangen ist.
Oder eines Mannes, der mit einem Elektroschocker traktiert wurde.
Desmond fühlt, wie seine Kiefermuskeln hart werden. Bis vor zwei Monaten hätte er nie geglaubt, dass das Klischee des sadistischen Wärters tatsächlich der Realität entsprechen könnte. Doch während die meisten Wärter zwar nicht besonders freundlich, aber auch nicht unverhohlen feindselig sind, lässt Stanimir klar erkennen, dass er einen Kick davon bekommt, Menschen zu terrorisieren. Ihnen weh zu tun.
Verwirrt schaut sich der Mexikaner um. Bill fasst ihn grob unter dem Arm und führt ihn aus dem Zimmer.
Stanimir dreht sich zu Desmond, sein Ausdruck derjenige eines Mannes, der gerade guten Sex hatte.
„Hey, der Klapsdoktor! Hast mich wohl vermisst?“
„Ativan.“ Desmonds Miene ist ausdruckslos. „Darf ich eins haben?“
Der Bulgare hebt eine Augenbraue. „Und ich dachte schon, du wärst wegen mir gekommen. Du brichst mir das Herz.“
Er dreht sich um und zieht eine Akte aus einem Archivschrank.
„Parker, Desmond … hmm! Tut mir leid, aber du hast dein Ativan heute schon gekriegt. So wie fast jeden Tag. Schau!“
Verständnislos starrt Desmond in die Akte, die ihm Stanimir vor das Gesicht hält. Auf einer Zeile im unteren Drittel, in der Rubrik ‚Reservemedikation‘, sieht er den Namen ATIVAN und daneben, säuberlich aufgelistet, gut zwanzig rote Kreuzchen. Eines für fast jeden Tag des Monats.
„Das … das stimmt nicht.“ Desmond zwingt sich, seine Fäuste zu lockern. „Ich habe das Ativan erst zweimal genommen!“
Stanimir schlägt die Akte zu. „Sorry, Dr. Freud, aber da muss dir deine Erinnerung einen Streich spielen. Du fährst ziemlich ab auf die kleinen gelben Dinger, so wie die meisten Benzo-Junkies.“
„Mistkerl“, knurrt Desmond durch die Zähne.
In Stanimirs Augen funkelt es. „Wie war das?“
„Du weißt genau, dass ich das Ativan weder heute noch in den letzten drei Wochen genommen habe!“
Der Bulgare öffnet die Tür und steht dicht vor Desmond, die Hand am Schlagstock.
„Nein, das weiß ich nicht, du kleiner Kacker. Weil in deiner Akte klar geschrieben steht, dass du eine miese kleine Benzo-Hure bist. Für eine Handvoll Ativan würdest du gleich hier und jetzt auf die Knie fallen und mir einen blasen – oder?“
Desmond hört das Klicken, als der Bulgare den Schlagstock vom Gürtel hakt.
„Verstehe.“ Desmonds Stimme ist heiser vor Wut. Er dreht sich um stapft zu seinem Zimmer zurück. Als er an der Nr. 3 vorbeigeht, öffnet sich schlagartig die Tür und eine dürre Hand packt ihn am Arm, zieht in in das Zimmer hinein.
Desmond schlägt die Hand weg und starrt in die rastlos zuckenden Augen von Scott Burnette.
„Gut!“ gurrt der Alte. „Sehr gut! Die Lebensgeister erwachen!“
„Fass mich noch einmal an, und ich –“
„Ah, ah, ah!“ Burnette tänzelt rückwärts um Desmond herum, ein grotesker Balletttänzer, und stößt die Tür zu.
Desmond ballt die Fäuste, unsicher, ob er einen alten Mann schlagen würde, um sich aus dessen Gegenwart zu befreien.
„Was zum Teufel willst du von mir?“
Burnette lächelt sein gruseliges Lächeln. „Ich bin der Augenöffner! Der Götterbote, der den Unwilligen das Licht der Erkenntnis bringt.“
„Okay.“ Desmond atmet tief durch. „Hör zu. Ich bin hundemüde, und ich will dir nicht weh tun … aber ich werde jetzt in mein Zimmer gehen, und wenn du dich mir in den Weg stellst – “
„Lausche der Botschaft!“ Unvermittelt breitet der Alte die Arme aus, wirft den Kopf in den Nacken und ruft in schrillem Falsett: „Entsaget dem Gift des Puppenspielers, und die Blinden werden sehen, die Lahmen gehen, und die Toten auferstehen! Matthäus Kapitel 11, Vers 5!“
Desmonds Kiefer sinkt nach unten. Diese Stimme!Ein Déjà-vu, nein, ein Déjà-entendu, das es nicht ganz in sein Bewusstsein schafft. Er richtet einen zitternden Finger auf den Alten.
„Wer zum Teufel bist du?“
Burnette schürzt die faltigen Lippen und legt den Kopf schief, ein hagerer Kobold.
„Du bist gestolpert.“ Der Tonfall einer Mutter, die mit ihrem leicht zurückgebliebenen Kind spricht. „Aber du musst wieder aufstehen. Auf die Füße kommen. Den Puppenspieler finden und ihn aus dem Weg räumen!“
Desmond macht einen Schritt rückwärts. „Du bist komplett verrückt.“
„Natürlich!“ kichert Burnette, während die stechenden Augen hin und her zucken. „Hier sind nämlich alleverrückt.“
Desmond stößt ihn zur Seite und verlässt fluchtartig das Zimmer, betritt schwer atmend sein eigenes.
Diese Stimme …
Erschöpft lässt er sich auf das Bett sinken, und sofort gleiten seine Augen zu.
Woher …?
Unvermittelt reißt er die Augen auf. Ich kenne diese Stimme! Ein Schauer geht durch seinen Körper, während er die unheimliche Szene in der WC-Kabine nochmals erlebt, auf dem Flug nach Kingston.
‚Hey, Kumpel! Du musst stark sein … nur der Mutige findet Gnade vor der Göttin.‘
Desmond kann die Stimme in seinem Kopf hören, als hätte jemand ein Tonband in seinen Schädel eingepflanzt.
‚Große Veränderungen stehen bevor … und ihre Vorboten kommen mit Feuer und Wasser.‘
Stocksteif liegt Desmond auf dem Bett, die Augen starr zur Decke gerichtet, während sein Herz in seiner Brust viel zu schnell schlägt, ein unheilvoller Trommelklang.
SECHS MONATE ZUVOR
Überleben
Ocho Rios, Jamaika – Samstag, 1:46 Uhr
Desmond krault durch das aufgewühlte Meer, die Augen starr auf die Hafenlichter von Ocho Rios gerichtet. Seine Arme und Beine sind flüssiger Schmerz, fremdartige Körperteile, die wie von alleine weiterkämpfen, während Desmonds Überlebenswille mit jeder Sekunde schwindet. Hohe Wellen klatschen ihm ins Gesicht, drücken ihn unter Wasser, während die Strömung ihn nach außen ziehen will, ins offene Meer. Der Schmerz der gebrochenen Rippe ist unerträglich, raubt ihm den Atem. Um ihn herum tobt der Sturm unvermindert weiter, als versuchten alle Naturgewalten, ihn aufzuhalten, ihn zu vernichten.
Schon in den ersten Sekunden hat sich Desmond nackt ausgezogen, bevor die nasse Kleidung ihn hinunterziehen konnte. Splitternackt kämpft er sich durch die kochende See, konzentriert sich auf die Lichter, die ihn leiten, auf den Schmerz, der ihn fühlen lässt, dass er noch lebt.
Noch.
Er denkt an Jean. Wenn er schon sterben muss, so soll Jean sein letzter Gedanke sein. Doch der Gedanke bringt keinen Frieden. Er stellt sich vor, wie sich Jean mit jeder Sekunde weiter von ihm entfernt, auf der Caribbean Mermaid im Sturm verschwindet, die Geißel eines sadistischen Psychopathen und Mörders.
Coppola.
Wie nebenbei wird Desmond bewusst, dass etwas mit ihm geschehen ist. Dass er auf den Kalabrier einen Hass empfindet, den er sich nie hätte vorstellen können. Ihm ist, als wäre Coppola ein Dämon, der ausgesandt wurde, ihn zu quälen, ihm alles zu nehmen – und ihn mit zerrissener Seele untergehen zu lassen.
Und ich habe ihn verschont …
Wie ein dunkler Tumor pulsiert die Erinnerung in Desmonds Kopf. Er sieht sich, wie er im Dschungel die Magnum auf den Kalabrier richtet, auf ihn zielt, den Finger am Abzug. Coppolas unerträglich süffisantes Lächeln. ‚Ich habe mich gerade gefragt, ob Sie die Eier haben, einen unbewaffneten Menschen einfach abzuknallen. Offenbar nicht.‘
Desmond schwimmt weiter, sein Geist im Urwald, jede Zelle in seinem Körper erfüllt vom glühenden Drang, den Kalabrier zu erschießen wie einen tollwütigen Hund. Er fühlt den Widerstand des Abzugs am Finger, fühlt den unsinnigen Widerstand tief in seiner Seele. Er denkt an den Vietnam-Veteranen mit dem weißen Bürstenhaarschnitt, den er von seiner PTBS befreit hatte; denkt an die Worte des Mannes während der ersten Sitzung, als sie über die unmenschlichen Massaker des Krieges sprachen.
‚Das Gehirn gewöhnt sich ans Töten, Mr. Parker … aber nicht die Seele. Wenn man zum ersten Mal einen Menschen tötet, öffnet man eine Tür, die sich nie mehr schließt. Eine Tür, die in eine unheimliche, fremdartige Dimension führt. Eine Dimension, die erschreckend ähnlich aussieht wie unsere normale Welt … aber es ist ein Trugbild, hinter dem sich Monster verstecken.
Mechanisch schwimmt Desmond weiter, sein ganzer Körper ein glühendes Stück Schmerz. Halb bewusstlos schließt er beim Schwimmen immer wieder die Augen, ein Mann kurz vor dem Ende. Jedes Zeitgefühl ist ihm verloren gegangen. Da sind nur Wellen, der schwarze Himmel, und die Lichter des Hafens, unendlich weit entfernt.
Coppola.
Desmond beobachtet sich beim Schwimmen, bemerkt mit losgelöster Verwunderung, wie seine Gedanken immer wieder zum Kalabrier zurückkehren.
Hör auf, ermahnt er sich selbst.Du bist Psychologe. Du weißt, dass diese Gedanken nirgendwo hinführen.
Tief in der Seele grinst etwas mit blitzenden Zähnen. Und wen genau versuchst du zum Narren zu halten? Etwa dich selbst?
Ohne große Gegenwehr akzeptiert er das Offensichtliche. Der neue Lebenszweck ist so simpel, dass ein einziges Wort genügt, diesen zu definieren.
Rache.
Desmond ist vertraut mit den Mechanismen, die hinter Wut und Rachegelüsten stehen, und das Wissen ändert rein gar nichts an der erhabenen Reinheit, an der Macht des Gefühls. Natürlich ist da eine Basis von Angst und Liebe, die ihn antreibt, Jean zu suchen, zu retten, ein neues Leben mit ihr zu beginnen. Doch gleichzeitig fühlt er, dass die wahre Kraft aus dem urwüchsigen Trieb stammt, das Böse in seinem Leben zu bekämpfen, zu vernichten.
Das bist nicht du,versucht es sein Verstand ein letztes Mal. Du wurdest traumatisiert. Du bist kein Killer!
Doch, das bist du, flüstert die andere Stimme, kalt und selbstsicher. Dein neues Ich. Dein wahres Ich.
Etwas berührt Desmond am Bein, und er zuckt zusammen, findet sich in der tobenden Gegenwart des Sturms wieder. Einen Moment lang ist er überzeugt, dass es der Hai ist, der gigantische Hammerhai, der zurückgekommen ist, um ihn zu verschlingen. Doch dann berühren seine Arme weitere Gegenstände.
Treibgut …?
Er hebt den Kopf und sieht, dass sich etwas verändert hat. Er erkennt Masten, die im Wind schaukeln. Sieht die Umrisse der im Hafen vertäuten Schiffskutter und Segelboote. Doch es kommt keine Hoffnung auf. Der Hafen, kaum noch dreihundert Meter entfernt, könnte ebensogut auf dem Mond liegen. Unter dem Schmerz fühlt Desmond seine Arme und Beine nicht mehr, und er nimmt eher kognitiv wahr, dass sie sich überhaupt noch bewegen.
Erst jetzt realisiert er, dass er tatsächlich aufgegeben hat – und mit der Kapitulation kommt eine seltsame, beinahe heitere Gleichmut.
Gleich ist alles vorbei.
Mit nüchterner Distanziertheit überlegt er, wie nahe er dem Hafen kommen wird, bevor er untergeht. Zweihundert Meter? Hundert?
Er schließt die Augen, fühlt, wie seine Arme immer langsamer werden, Windmühlenflügel, die in einer Flaute auslaufen.
Etwas schlägt gegen seinen Kopf, staucht seinen Hals. Erschrocken strampelt Desmond, um sich über Wasser zu halten – und sieht einen blauweißen Fender vor sich, dahinter den hölzernen Rumpf eines Kutters.
Der Hafen … ich hab ihn erreicht!
Kaum noch fähig, seinen Körper zu kontrollieren, kämpft sich Desmond um den Kutter, zum Steg. Oh nein.Der Steg liegt einen halben Meter über dem Meeresspiegel. Unter normalen Umständen wäre es für Desmond ein Leichtes, sich mit einem Klimmzug hochzustemmen, doch jetzt fühlt er, wie seine Kraftreserven aufgebraucht sind. Eine hohe Welle klatscht über seinen Kopf hinweg, und er sinkt, sinkt. Loslassen … einfach loslassen …
Auf einmal sieht er Coppola vor sich. Der Kalabrier trägt ein buntes Hawaii-Hemd und den selbstgefälligen Ausdruck von ultimativem Triumph.
Ich gewinne, Desmond, grinst er. Immer. Und diesmal gehört der Schatz mir …
Neben Coppola steht plötzlich Jean, hohläugig, resigniert, ihr nasses Haar an der Stirn klebend. Ihr gelbes Kleid ist zerfetzt wie bei einer Schiffbrüchigen. Der Kalabrier legt einen Arm um ihre Schulter, berührt wie beiläufig den Ansatz ihrer Brust.
Desmonds Körper beginnt zu zucken. Seine Arme holen aus, bewegen sich in weiten Bögen seitwärts nach hinten. Unter Wasser schwimmt er los, aufs Geratewohl, zum Strand oder ins offene Meer. Seine Ellenbogen berühren etwas Hartes.
Steingeröll …
Mit unkoordinierten Bewegungen schleppt er sich den Steinstrand hoch, fühlt kaum, wie das scharfe Geröll in seine nackte Haut schneidet. Aus dem Augenwinkel sieht er seine Arme zittern, als stünden sie unter Strom – dann bricht er zusammen, schlägt mit dem Kopf auf einen Stein. Wellen strömen über seine Beine, während aus seiner Schläfe Blut sickert.



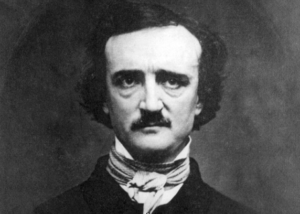


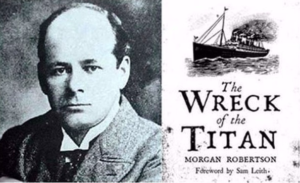

 Persönlich erlebte ich mein erstes Spinnentrauma im zarten Alter von sechs Jahren, als ich bei meiner Großmutter Jeremias Gotthelfs Originalausgabe von „
Persönlich erlebte ich mein erstes Spinnentrauma im zarten Alter von sechs Jahren, als ich bei meiner Großmutter Jeremias Gotthelfs Originalausgabe von „



 Im folgenden Artikel befassen sich Fachleute ganz verschiedener Disziplinen mit dem Thema Chaos und Ordnung, und sie alle betreten die neblige Zone zwischen Wissenschaft und dem Unerklärlichen: ein Psychologe, ein Dirigent, ein Physiker, ein Biologe und eine Philosophin. Lassen Sie sich inspirieren!
Im folgenden Artikel befassen sich Fachleute ganz verschiedener Disziplinen mit dem Thema Chaos und Ordnung, und sie alle betreten die neblige Zone zwischen Wissenschaft und dem Unerklärlichen: ein Psychologe, ein Dirigent, ein Physiker, ein Biologe und eine Philosophin. Lassen Sie sich inspirieren!